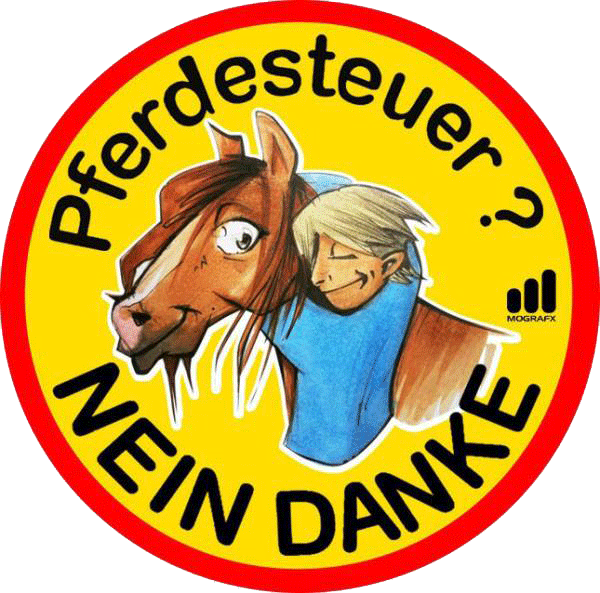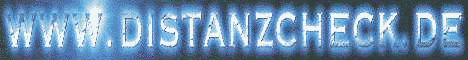...weiteste Anreise ist garantiert
Transgermania-Film im Kino Bremen!
Forumsregeln
Das Distanzforum übernimmt keine Garantie über die Richtigkeit der Ritttermine und/oder der Ausschreibungen.
Das Distanzforum übernimmt keine Garantie über die Richtigkeit der Ritttermine und/oder der Ausschreibungen.
-
 Nirak
Nirak - ForenSpezialist

- Beiträge: 4295
- Registriert: Montag 12. Juli 2004, 09:38
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 317 Mal
- Kontaktdaten:
Feb 2025
19
15:24
Re: Transgermania-Film im Kino Bremen!
Wahnsinn!!!
...weiteste Anreise ist garantiert
...weiteste Anreise ist garantiert
- Flaumur
- HopTop

- Beiträge: 1285
- Registriert: Sonntag 8. Februar 2004, 13:45
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danksagung erhalten: 36 Mal
Feb 2025
19
20:39
Re: Transgermania-Film im Kino Bremen!
der Wolfhager Kinobetreiber hat heute Abend auf meine Anfrage hin mit Ralf Schauwacker telefoniert und will den Film hier auch zeigen =)
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Flaumur für den Beitrag (Insgesamt 8):
- Hiskea (Mittwoch 19. Februar 2025, 20:52) • Charlie (Mittwoch 19. Februar 2025, 21:52) • Jolly (Mittwoch 19. Februar 2025, 22:00) • Sigrun (Donnerstag 20. Februar 2025, 14:23) • Faesschen (Freitag 21. Februar 2025, 14:47) • Zwockel (Freitag 21. Februar 2025, 18:32) • Nirak (Samstag 22. Februar 2025, 10:03) • polldi (Samstag 22. Februar 2025, 16:39)
- Flaumur
- HopTop

- Beiträge: 1285
- Registriert: Sonntag 8. Februar 2004, 13:45
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danksagung erhalten: 36 Mal
Feb 2025
21
16:52
Re: Transgermania-Film im Kino Bremen!
Wolfhagen/Kassel: 26.3.2015 um 20.15 Uhr *freu*
https://kino-wolfhagen.de/programm/film ... -kilometer
https://kino-wolfhagen.de/programm/film ... -kilometer
-
 ulibarbara
ulibarbara - Insider

- Beiträge: 381
- Registriert: Donnerstag 3. Oktober 2019, 21:45
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 81 Mal
Feb 2025
21
18:48
Re: Transgermania-Film im Kino Bremen!
och menno eine Woche vorher wäre ich sogar bei Kassel.
-
 Anja17
Anja17 - Schnellschreiber

- Beiträge: 622
- Registriert: Donnerstag 3. März 2005, 21:04
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
- Kontaktdaten:
Feb 2025
22
09:19
Re: Transgermania-Film im Kino Bremen!
Ich kann morgen leider nicht dabei sein. Mich hat ne Erkältung total lahm gelegt  .
.
Majális: 538 km i.d.W.
Laika: 15 Jahre erfolgreich auf der Strecke, 3.190 km i.d. W. († 2019)
Ich: 3.728 km i.d.W.
http://distanzreiterin.de/
Laika: 15 Jahre erfolgreich auf der Strecke, 3.190 km i.d. W. († 2019)
Ich: 3.728 km i.d.W.
http://distanzreiterin.de/
-
Pfadfinder
- Super Poster

- Beiträge: 100
- Registriert: Sonntag 16. Juli 2006, 21:10
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
-
 Pinot Grigio
Pinot Grigio - High Poster

- Beiträge: 268
- Registriert: Montag 20. August 2012, 14:35
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Feb 2025
23
18:42
Re: Transgermania-Film im Kino Bremen!
Das war doch richtig schön! Und auch so ein nettes Wiedersehen! So viele sind gekommen teils weit angereist.
Und im Kino auf jeden Fall beeindruckender, als zu Hause aufm Fernseher!
Und im Kino auf jeden Fall beeindruckender, als zu Hause aufm Fernseher!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Pinot Grigio für den Beitrag (Insgesamt 7):
- Sigrun (Sonntag 23. Februar 2025, 19:55) • Jolly (Sonntag 23. Februar 2025, 20:36) • Beta (Sonntag 23. Februar 2025, 21:27) • Flaumur (Sonntag 23. Februar 2025, 21:33) • Pfadfinder (Sonntag 23. Februar 2025, 22:41) • Pat (Montag 24. Februar 2025, 08:40) • Zwockel (Montag 24. Februar 2025, 17:39)
- polldi
- ForenSpezialist

- Beiträge: 3285
- Registriert: Montag 19. September 2011, 14:09
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Feb 2025
23
20:38
Re: Transgermania-Film im Kino Bremen!
https://m.youtube.com/watch?v=WVuwEjCLT ... =2&pp=iAQB
Kurioserweise wird er mir mobil auf dem Handy nicht angezeigt. Da gibts nur den Trailer.
Kurioserweise wird er mir mobil auf dem Handy nicht angezeigt. Da gibts nur den Trailer.
-
 DrSabine
DrSabine - ForenGuru

- Beiträge: 2361
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 18:51
- Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 1133 Mal
Feb 2025
23
21:01
Re: Transgermania-Film im Kino Bremen!
Wie hast du ihn gefunden? Der Film ist nicht gelistet und wurde lediglich einem Redakteur zur Verfügung gestellt.
Wir nehmen ihn da jetzt natürlich raus!
Wir nehmen ihn da jetzt natürlich raus!
- polldi
- ForenSpezialist

- Beiträge: 3285
- Registriert: Montag 19. September 2011, 14:09
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Feb 2025
23
21:58
Re: Transgermania-Film im Kino Bremen!
Google. Auf der Suche nach dem Trailer 
Danke für's Löschen, hatte vermutet soll so nicht sein.
Danke für's Löschen, hatte vermutet soll so nicht sein.
-
 DrSabine
DrSabine - ForenGuru

- Beiträge: 2361
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 18:51
- Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 1133 Mal
Feb 2025
24
07:37
Re: Transgermania-Film im Kino Bremen!
Ich sags ja immer, das Internet ist eine Postkarte. Ich fand es auch nicht gerade prickelnd, als meine Firma den Versand der Gehaltsabrechnungen per email erzwungen hat. Natürlich war das passwortgeschützt, ha ha. Ich mach auch kein online banking, warum wohl?
Egal, nun ist er raus. Der Film ist kein öffentliches Allgemeingut, zumindest noch für längere Zeit nicht.
Egal, nun ist er raus. Der Film ist kein öffentliches Allgemeingut, zumindest noch für längere Zeit nicht.
-
 babara
babara - HopTop

- Beiträge: 1429
- Registriert: Mittwoch 10. März 2004, 16:49
- Hat sich bedankt: 237 Mal
- Danksagung erhalten: 52 Mal
- Kontaktdaten:
Feb 2025
24
11:01
Re: Transgermania-Film im Kino Bremen!
Die TAZ hat den Film offensichtlich gesehen und einen in meinen Augen ganz besch...eide...nen Artikel geschrieben: https://taz.de/Doku-ueber-Wanderreiter/!6067160/
LG, Barbara
SportAraber-Datenbank: https://araber-sportpferde.de
Infos zum arabischen Vollblut: https://info.baschwa.net
SportAraber-Datenbank: https://araber-sportpferde.de
Infos zum arabischen Vollblut: https://info.baschwa.net
-
 DrSabine
DrSabine - ForenGuru

- Beiträge: 2361
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 18:51
- Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 1133 Mal
Feb 2025
24
11:07
Re: Transgermania-Film im Kino Bremen!
Ja genau, die TAZ hatte den Film angeschaut, um eine Art Rezension zu schreiben. Die finde ich auch wenig gelungen.
-
 Sigrun
Sigrun - Foren König||Foren Königin

- Beiträge: 5039
- Registriert: Sonntag 8. Februar 2004, 09:19
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danksagung erhalten: 375 Mal
Feb 2025
24
11:40
Re: Transgermania-Film im Kino Bremen!
MIr ging das den ganzen Abend nicht mehr aus dem Kopf. Ich meine, Taz und Tiere geht sowieso regelmäßig dramatisch daneben, aber hier war es ein freier Filmkritiker und Kulturjournalist, der halt für die Taz diese Kritik geschrieben hat und bei der überwiegend städtischen Taz hat es halt auch niemanden genug interessiert bzw. sein Urteil passte gut zu den Vorurteilen.
Jetzt mal mein Verriss seiner Kritik aus Sicht von jemandem, der sich für Film, Journalismus und Distanzreiten interessiert und in allen drei Feldern über sehr basales Grundwissen verfügt, also aus meiner Sicht.
A) Der Journalist hat offensichtlich nicht mal minimal das Thema recherchiert, von dem der Film handelt (eine Sportart, draußen, Ausdauer über mehrere Wochen.) Weshalb er z.B. nicht verstand, was die "scheinbar allgegenwärtigen Tierärztinnen" da sollten, worin die Leistung bestand und unter welchen Voraussetzungen der Film gedreht wurde. Also ... Recherche, die Grundlage jeglichen journalistischen Arbeitens - hat er nicht gemacht.
B) Der Filmkritiker hat sich offensichtlich nicht damit beschäftigt, was ein Dokumentarfilm ist, kann und soll und wie sich die Produktionsbedingungen in den diversen Gattungen des Films auf den Inhalt und das Ergebnis auswirken. Das ist ebenfalls Grundwissen und hätte zusammen mit Recherche zu einem besseren Ergebnis geführt.
C) Der Journalist vor Ort guckt zu und hört zu, möglichst unvoreingenommen und mit einem weiten Blickwinkel, bevor er a) möglichst neutral wiedergibt, was er gesehen und gehört hat, und b) das Geschehen in den Kontext einordnet und / oder c) je nach Aufgabe seine Einschätzung und Meinung über das Gesehene, Gehörte und Eingeordnete bildet und für sein Publikum formuliert, damit die sich die ganze Arbeit nicht machen müssen.
Dass beim Dokumentarfilm das Thema und Produktionsbedingungen einander gegenseitig viel stärker bedingen als bei einem Film, der in einem Studio gedreht wird oder eine ausgedachte Handlung erzählt, für die man dann passende Drehorte sucht - lernt man ehrlich gesagt im Grundstudium und auch in jedem Volontariat, das man beim Fernshen oder Radio macht, beim Radio bei der allerersten Reportage, wenn die O-Töne scheiß geworden sind, weil im Hintergrund irgendeine Alarmanlage losging, die man entweder nicht gehört hat, weil man auf seinen Interviewpartner konzentriert war oder die man ignoriert hat, weil sonst der Interviewepartner weg gewesen wäre, weil er noch was vorhat an dem Tag.
In jedem geisteswissenschaftlichen Grundstudium, das "irgendwas mit Medien" beinhaltet, geht es z.B. als Erstes mal um Erzählformen oder journalistische Gattungen (Text, Radio, Film - Internet und Social Media war noch nicht erfunden, als ich studiert habe) je nachdem, was man studiert, und damit darum, wie Produktionsbedingungen das Ergebnis beeinflussen. Ich habe diesen Umstand sowohl in "Neue deutsche Literatur und Medien" als auch in "Medienwissenschaften" als auch in "Publizistik" kennen gelernt und nicht erst im Seminar "Dokumentarfilm" oder "Filmanalyse".
Gerade im Gespräch nach dem Film war nochmal gut zu lernen, welche Schwierigkeiten z.B. beim Filmen von Pferden in Bewegung in der freien Landschaft sich so stellen, was es bedeutet, ein Geschehen zu filmen, von dem man morgens gar nicht weiß, wo es in 2 Stunden überhaupt stattfinden wird - wenn man sich also nicht mal den Drehort vorher aussuchen kann, weil man gar nicht weiß, wo die Reiter lang kommen, weil es ein Kartenritt ist, geschweige denn irgendwas absperren, das Licht richtig ausrichten, den Ton passend machen und dann alle x-fach dieselbe Straße lang laufen lassen, bis alles schön passend im Kasten ist wie im Erzählfilm - welche Gedanken beim Schnitt noch in die Bildideen und v.a. auch den Ton eingeflossen sind.
Aber unser Kritiker war halt nicht da, sondern hat sich den Film vorher angesehen und sich vermutlich gelangweilt, weil ihn weder Thema noch die Form interessierten.
Wenn man mitbekommen hat, was da erzählt wurde, und wie es erzählt wurde, konnte man mitbekommen, dass es auf allen Ebenen - im Bild, im Ton und in den Aussagen der Teilnehmenden - erzählt wurde. Hätte man merken können, hätte man A und B beachtet und C getan.
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es ein sehr gut Dokumentarfilm geworden ist, viel besser, als ich noch gestern nachmittag dachte. Der Film glänzt gerade bei dem, was vielleicht auf den nicht wohlgesonnen intellektuellen Kunstfilmkritiker vermutlich etwas uninspiriert gewirkt hat.
Wenn wir uns mal die verwendeten Perspektiven (= Erzählform) ansehen, fällt v.a. der Wechsel zwischen Totale / Drohnenaufnahme / Strecke und Nahaufnahme mit Interview / O-Ton / Teilnehmer auf. Das ist zu einem großen Teil den Produktionsbedingungen geschuldet. Dazwischen gibt's auch mal Halbtotale (sorry, nach 30 Jahren sitzen die Begriffe ggf. nicht mehr ganz so sicher, falls ich hier was falsch bezeichne). zb. in den meditative Sequenzen von Pferdeköpfen im Trab mit Hufschlag dazu - der dann auch in der Musik / im Ton über den ganzen Film wieder aufgenommen wurde.
Produktionsbedingungen: Dafür muss man halt im öffentlichen Verkehrsraum neben einem trabenden Pferd herfahren und filmen, Licht, Wind und Außengeräusche müssen passen und Pferd und Reiter und ggf. die 3- 5 anderen Pferde und Reiter und der gesamte restliche Verkehr muss es erlauben. So rasend viel Spielraum für andere Aufnahmeperspektiven bietet z.b. ein asphaltierter Feldweg in Bayern nicht um 11:30 Uhr, wenn das tolerante Pferd, der ausgeglichene Reiter mit der Gruppe, die ihre Position halten können, da vorbei kommen, wo das Auto mit der Filmcrewe wartet, weil Licht von schräg hinten und heute wenig Wind genau da gerade kein Trecker lang möchte und kein Gegenverkehr herrscht.
Ton: Der Fun Fact, dass diese "Musik" als Trommeln auf einem Wasserkanister vor Ort aufgenommen wurde - was auch im Film zu sehen war - , bietet nochmal eine weitere Vielschichtigkeit, die dann vielleicht wirklich nur noch Distanzreiter nachvollziehen könnten. Oderein Studienanfänger im ersten Semester im Seminar "Filmanalyse", der sich über das Thema des Films informiert hat und gesehen hat, dass Wasser eine Rolle spielt: Thema "Leitmotive", braucht man für alle journalistischen und literarischen Gattungen, egal welches Medium. Könnte man erkennen, wenn man a) sich vorher informiert und b) zuguckt und zuhört. Das ist dann schon richtig tief im Thema, hier wird's komplex und interessant. (Leitmotive in Ton und Bild verknüpfen einzelne Szenen und stellen Zusammenhänge her. Grundstudium, vielleicht sogar Laberfach, Sekundarstufe 2)
In der Form gibt der Film genau das wieder, was u.a. das Transgermania Erlebnis ausmacht: ein übers Ganze betrachtet relativ gleichförmiges Geschehen mit immer gleicher Struktur (Tagesablauf, Vetgates usw) an wechselnden Orten durch wechselnde Landschaften mit wechselnden regionalen Spezialitäten (Fußnote: hier ist der Norden zu kurz gekommen, irgendwann gab's wohl keine Spezialitäten mehr oder dem Filmemacher erschien es zunehmend unspektakulärer, je näher es seiner eigenen Heimat ging, weshalb es ihm nicht mehr erwähnenswert erschien? Dieses sowohl strukturelle als auch inhaltliche Leitmotiv ist irgendwann abgebrochen und wurde nicht zu Ende geführt, Kritikpunkt, zeigt aber evtl. auch nochmal wie Produktionsbedingungen und Ergebnis einander bedingen) einen Ausdauerwettbewerb in täglich denselben Strukturen, mit einem - abgesehen von vielen kleinen oder größeren Dramen in den einzelnen Teams, die der Film nicht alle abbilden kann, aber schlaglichartig beleuchtet - allmählichen Spannungsbogen, an dessen Anfang für viele Jahre der Vorbereitung, Erwartungen und Befürchtungen stehen, dann das meditative Sein auf der Strecke abseits von allem, was das sonstige Leben ausmacht, dann die Freude und Furcht vor dem Ankommen und am Ende die ganze Freude, Rührung und gleichzeitig Trauer darüber, das es zu Ende ist. Und das alles erlebt der Zuschauer dann auch mit, wenn er zuhört und zuguckt. Ganz ehrlich: da ist alles dabei, was einen guten Film ausmacht.
Inzwischen bin ich der Meinung, dass es ein Dokumentarfilm ist, bei dem Form, Inhalt und Botschaft besser zusammenpassen als man auf den ersten Blick meint. Man muss halt hingucken und zuhören wollen.
Für ungeduldige Ahnungslose könnte man das Ganze vielleicht auf 20 Minuten eindampfen oder einen 6 Minuten Imagefilm draus machen, aber es wär dann halt nicht das, was der Film erzählen wollte und böte auch nicht dasselbe immersives Kinoerlebnis, auf das unser Kritiker sich anscheinend nicht einlassen wollte oder konnte, aufgrund der Vernachlässigung seiner handwerklichen Pflicht.
Also: der Kritiker hat nicht den Mindestaufwand getrieben, um sich über das Thema des Films zu informieren (journalistisches Handwerk nicht angewendet) und ihm fehlt offensichtlich das Wissen darüber, was einen Dokumentarfilm von einem Studiofilm oder einem Film mit ausgedachter Handlung unterscheidet (Grundwissen nicht beachtet) oder es war ihm egal, und er hat sich nicht die Mühe gemacht, den Film unvoreingenommen anzusehen und anzuhören (was irgendwie die Grundbedingung für jegliches journalistisches Tun ist).
Tja, bisschen traurig für jemanden, der als Journalist (Recherchieren, Wahrnehmen, was ist) und Filmkritiker (Proseminar 1: Erzählformen im Film und ihre konstituierenden Faktoren) arbeitet.
Jetzt mal mein Verriss seiner Kritik aus Sicht von jemandem, der sich für Film, Journalismus und Distanzreiten interessiert und in allen drei Feldern über sehr basales Grundwissen verfügt, also aus meiner Sicht.
A) Der Journalist hat offensichtlich nicht mal minimal das Thema recherchiert, von dem der Film handelt (eine Sportart, draußen, Ausdauer über mehrere Wochen.) Weshalb er z.B. nicht verstand, was die "scheinbar allgegenwärtigen Tierärztinnen" da sollten, worin die Leistung bestand und unter welchen Voraussetzungen der Film gedreht wurde. Also ... Recherche, die Grundlage jeglichen journalistischen Arbeitens - hat er nicht gemacht.
B) Der Filmkritiker hat sich offensichtlich nicht damit beschäftigt, was ein Dokumentarfilm ist, kann und soll und wie sich die Produktionsbedingungen in den diversen Gattungen des Films auf den Inhalt und das Ergebnis auswirken. Das ist ebenfalls Grundwissen und hätte zusammen mit Recherche zu einem besseren Ergebnis geführt.
C) Der Journalist vor Ort guckt zu und hört zu, möglichst unvoreingenommen und mit einem weiten Blickwinkel, bevor er a) möglichst neutral wiedergibt, was er gesehen und gehört hat, und b) das Geschehen in den Kontext einordnet und / oder c) je nach Aufgabe seine Einschätzung und Meinung über das Gesehene, Gehörte und Eingeordnete bildet und für sein Publikum formuliert, damit die sich die ganze Arbeit nicht machen müssen.
Dass beim Dokumentarfilm das Thema und Produktionsbedingungen einander gegenseitig viel stärker bedingen als bei einem Film, der in einem Studio gedreht wird oder eine ausgedachte Handlung erzählt, für die man dann passende Drehorte sucht - lernt man ehrlich gesagt im Grundstudium und auch in jedem Volontariat, das man beim Fernshen oder Radio macht, beim Radio bei der allerersten Reportage, wenn die O-Töne scheiß geworden sind, weil im Hintergrund irgendeine Alarmanlage losging, die man entweder nicht gehört hat, weil man auf seinen Interviewpartner konzentriert war oder die man ignoriert hat, weil sonst der Interviewepartner weg gewesen wäre, weil er noch was vorhat an dem Tag.
In jedem geisteswissenschaftlichen Grundstudium, das "irgendwas mit Medien" beinhaltet, geht es z.B. als Erstes mal um Erzählformen oder journalistische Gattungen (Text, Radio, Film - Internet und Social Media war noch nicht erfunden, als ich studiert habe) je nachdem, was man studiert, und damit darum, wie Produktionsbedingungen das Ergebnis beeinflussen. Ich habe diesen Umstand sowohl in "Neue deutsche Literatur und Medien" als auch in "Medienwissenschaften" als auch in "Publizistik" kennen gelernt und nicht erst im Seminar "Dokumentarfilm" oder "Filmanalyse".
Gerade im Gespräch nach dem Film war nochmal gut zu lernen, welche Schwierigkeiten z.B. beim Filmen von Pferden in Bewegung in der freien Landschaft sich so stellen, was es bedeutet, ein Geschehen zu filmen, von dem man morgens gar nicht weiß, wo es in 2 Stunden überhaupt stattfinden wird - wenn man sich also nicht mal den Drehort vorher aussuchen kann, weil man gar nicht weiß, wo die Reiter lang kommen, weil es ein Kartenritt ist, geschweige denn irgendwas absperren, das Licht richtig ausrichten, den Ton passend machen und dann alle x-fach dieselbe Straße lang laufen lassen, bis alles schön passend im Kasten ist wie im Erzählfilm - welche Gedanken beim Schnitt noch in die Bildideen und v.a. auch den Ton eingeflossen sind.
Aber unser Kritiker war halt nicht da, sondern hat sich den Film vorher angesehen und sich vermutlich gelangweilt, weil ihn weder Thema noch die Form interessierten.
Wenn man mitbekommen hat, was da erzählt wurde, und wie es erzählt wurde, konnte man mitbekommen, dass es auf allen Ebenen - im Bild, im Ton und in den Aussagen der Teilnehmenden - erzählt wurde. Hätte man merken können, hätte man A und B beachtet und C getan.
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es ein sehr gut Dokumentarfilm geworden ist, viel besser, als ich noch gestern nachmittag dachte. Der Film glänzt gerade bei dem, was vielleicht auf den nicht wohlgesonnen intellektuellen Kunstfilmkritiker vermutlich etwas uninspiriert gewirkt hat.
Wenn wir uns mal die verwendeten Perspektiven (= Erzählform) ansehen, fällt v.a. der Wechsel zwischen Totale / Drohnenaufnahme / Strecke und Nahaufnahme mit Interview / O-Ton / Teilnehmer auf. Das ist zu einem großen Teil den Produktionsbedingungen geschuldet. Dazwischen gibt's auch mal Halbtotale (sorry, nach 30 Jahren sitzen die Begriffe ggf. nicht mehr ganz so sicher, falls ich hier was falsch bezeichne). zb. in den meditative Sequenzen von Pferdeköpfen im Trab mit Hufschlag dazu - der dann auch in der Musik / im Ton über den ganzen Film wieder aufgenommen wurde.
Produktionsbedingungen: Dafür muss man halt im öffentlichen Verkehrsraum neben einem trabenden Pferd herfahren und filmen, Licht, Wind und Außengeräusche müssen passen und Pferd und Reiter und ggf. die 3- 5 anderen Pferde und Reiter und der gesamte restliche Verkehr muss es erlauben. So rasend viel Spielraum für andere Aufnahmeperspektiven bietet z.b. ein asphaltierter Feldweg in Bayern nicht um 11:30 Uhr, wenn das tolerante Pferd, der ausgeglichene Reiter mit der Gruppe, die ihre Position halten können, da vorbei kommen, wo das Auto mit der Filmcrewe wartet, weil Licht von schräg hinten und heute wenig Wind genau da gerade kein Trecker lang möchte und kein Gegenverkehr herrscht.
Ton: Der Fun Fact, dass diese "Musik" als Trommeln auf einem Wasserkanister vor Ort aufgenommen wurde - was auch im Film zu sehen war - , bietet nochmal eine weitere Vielschichtigkeit, die dann vielleicht wirklich nur noch Distanzreiter nachvollziehen könnten. Oderein Studienanfänger im ersten Semester im Seminar "Filmanalyse", der sich über das Thema des Films informiert hat und gesehen hat, dass Wasser eine Rolle spielt: Thema "Leitmotive", braucht man für alle journalistischen und literarischen Gattungen, egal welches Medium. Könnte man erkennen, wenn man a) sich vorher informiert und b) zuguckt und zuhört. Das ist dann schon richtig tief im Thema, hier wird's komplex und interessant. (Leitmotive in Ton und Bild verknüpfen einzelne Szenen und stellen Zusammenhänge her. Grundstudium, vielleicht sogar Laberfach, Sekundarstufe 2)
In der Form gibt der Film genau das wieder, was u.a. das Transgermania Erlebnis ausmacht: ein übers Ganze betrachtet relativ gleichförmiges Geschehen mit immer gleicher Struktur (Tagesablauf, Vetgates usw) an wechselnden Orten durch wechselnde Landschaften mit wechselnden regionalen Spezialitäten (Fußnote: hier ist der Norden zu kurz gekommen, irgendwann gab's wohl keine Spezialitäten mehr oder dem Filmemacher erschien es zunehmend unspektakulärer, je näher es seiner eigenen Heimat ging, weshalb es ihm nicht mehr erwähnenswert erschien? Dieses sowohl strukturelle als auch inhaltliche Leitmotiv ist irgendwann abgebrochen und wurde nicht zu Ende geführt, Kritikpunkt, zeigt aber evtl. auch nochmal wie Produktionsbedingungen und Ergebnis einander bedingen) einen Ausdauerwettbewerb in täglich denselben Strukturen, mit einem - abgesehen von vielen kleinen oder größeren Dramen in den einzelnen Teams, die der Film nicht alle abbilden kann, aber schlaglichartig beleuchtet - allmählichen Spannungsbogen, an dessen Anfang für viele Jahre der Vorbereitung, Erwartungen und Befürchtungen stehen, dann das meditative Sein auf der Strecke abseits von allem, was das sonstige Leben ausmacht, dann die Freude und Furcht vor dem Ankommen und am Ende die ganze Freude, Rührung und gleichzeitig Trauer darüber, das es zu Ende ist. Und das alles erlebt der Zuschauer dann auch mit, wenn er zuhört und zuguckt. Ganz ehrlich: da ist alles dabei, was einen guten Film ausmacht.
Inzwischen bin ich der Meinung, dass es ein Dokumentarfilm ist, bei dem Form, Inhalt und Botschaft besser zusammenpassen als man auf den ersten Blick meint. Man muss halt hingucken und zuhören wollen.
Für ungeduldige Ahnungslose könnte man das Ganze vielleicht auf 20 Minuten eindampfen oder einen 6 Minuten Imagefilm draus machen, aber es wär dann halt nicht das, was der Film erzählen wollte und böte auch nicht dasselbe immersives Kinoerlebnis, auf das unser Kritiker sich anscheinend nicht einlassen wollte oder konnte, aufgrund der Vernachlässigung seiner handwerklichen Pflicht.
Also: der Kritiker hat nicht den Mindestaufwand getrieben, um sich über das Thema des Films zu informieren (journalistisches Handwerk nicht angewendet) und ihm fehlt offensichtlich das Wissen darüber, was einen Dokumentarfilm von einem Studiofilm oder einem Film mit ausgedachter Handlung unterscheidet (Grundwissen nicht beachtet) oder es war ihm egal, und er hat sich nicht die Mühe gemacht, den Film unvoreingenommen anzusehen und anzuhören (was irgendwie die Grundbedingung für jegliches journalistisches Tun ist).
Tja, bisschen traurig für jemanden, der als Journalist (Recherchieren, Wahrnehmen, was ist) und Filmkritiker (Proseminar 1: Erzählformen im Film und ihre konstituierenden Faktoren) arbeitet.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sigrun für den Beitrag (Insgesamt 13):
- Pfadfinder (Montag 24. Februar 2025, 11:49) • Anett (Montag 24. Februar 2025, 12:02) • Anja17 (Montag 24. Februar 2025, 12:21) • Darling (Montag 24. Februar 2025, 12:23) • babara (Montag 24. Februar 2025, 12:36) • Flaumur (Montag 24. Februar 2025, 14:02) • Leasusanne (Montag 24. Februar 2025, 14:46) • Nirak (Montag 24. Februar 2025, 16:33) • Noell (Montag 24. Februar 2025, 17:24) • Zwockel (Montag 24. Februar 2025, 17:44) und 3 weitere Benutzer
"Nicht das Reitsystem als solches ist ausschlaggebend, ob sich die Reiterei auf einem Wellenberg oder in einem Wellental befindet, sondern ausschließlich die Art, wie es vom Menschen gehandhabt wird. (Kurt Albrecht)
-
 DrSabine
DrSabine - ForenGuru

- Beiträge: 2361
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 18:51
- Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 1133 Mal
Feb 2025
24
13:17
Re: Transgermania-Film im Kino Bremen!
Komm, immerhin gab es noch Fischsuppe! Die Kulinarik hing halt entscheidend davon ab, wann und wo das Filmteam unterwegs essen gegangen ist.
Hat jemand gemerkt, dass wir gar nicht in Oberbayern waren?
Und wer hat das Pferd gefunden, das gar nicht im Wettbewerb war (außer Barbara, die hat es gleich gemerkt!). Ich hätte es rausschneiden lassen können, fand es aber als Goof echt witzig!
Vielleicht solltest Du deinen Beitrag als Leserbrief an die TAZ schicken...